Unser Projekt zur besseren Patientenversorgung
Jährlich werden in Deutschland mehr als acht Millionen Menschen mit einem Alter über 65 Jahren im stationären Setting aufgenommen. Sie kommen mit Frakturen, Pneumonien oder Harnwegsinfektionen ins Krankenhaus, viel häufiger aber benötigen sie mehr als die übliche Behandlung. Denn von diesen Patient*innen leiden bis zu 40% an einer, teils nicht bekannten, kognitiven Einschränkung oder einer bekannten dementiellen Erkrankung. Viele von diesen, aber auch von vorher „Hirngesunden“ entwickeln im Verlauf ihrer Erkrankung ein Delir.
„Im Delir erkennen wir den gesamten Menschen, der das gesamte geriatrische Team von der Reinigungskraft, der Pflege, den Therapeut*innen, Ärzt*innen und allen weiteren Teammitgliedern erfordert.“
Genau dieser Aufgabe möchten wir uns gemeinsam stellen und diesen Patientinnen und Patienten noch mehr gerecht werden. Aus diesem Grund haben wir das Projekt „Delirsensibles Krankenhaus“ ins Leben gerufen.
Delirsensibel steht für uns noch über dem demenzsensiblen Krankenhaus. Sehr häufig wird über die Patientinnen und Patienten mit der Diagnose „Demenz“ gesprochen. Viele räumliche Gegebenheiten und Therapiemöglichkeiten werden für diese angepasst und Informationsschreiben beinhalten viele gute Informationen für dieses Krankheitsbild.
Dabei gerät eine aber noch viel größere Patient*innengruppe in den Hintergrund: Patientinnen und Patienten mit einem akuten Delir.
Was ist ein Delir?
Ein Delir ist ein akuter Verwirrtheitszustand, der oft passager stattfindet, aber auch mitunter sehr lange anhalten kann. Es ist somit kein Durchgangssyndrom, das irgendwann vorbei ist, daher betrachten wir das Delir als einen Notfall, eine bedrohliche Situation.
Patientinnen und Patienten, die an einem Delir erkrankt sind, werden häufig durch die normale Krankenhaussituation zusätzlich belastet, da sie die fremde Umgebung und die unbekannten Abläufe nicht immer einordnen können und daher schnell überfordert sind.
Und genau diesem möchten wir „sensibel“ begegnen, indem wir diese Patientinnen und Patienten mit geschultem Auge im ersten Schritt erkennen, um dann auf sie eingehen zu können. Dabei versuchen wir, ihre besonderen Bedürfnisse und Erwartungen wahrzunehmen und diese in die Gestaltung der Versorgungsstrukturen und unserer Abläufe zu integrieren.
Eine „Delirsensibilität“ erreichen wir durch unsere grundsätzliche Haltungsänderung des gesamten Personals und im interdisziplinären Team.
Die für unser „delirsensibles“ Krankenhaus so wichtigen Bausteine fußen auf sechs Säulen:
- die Sensibilisierung und Bildung des Personals
- die Strukturierung von Tagesabläufen
- baulich-räumliche Anpassungen
- die Einbindung der Angehörigen
- therapeutische Maßnahmen
- die Intensivierung persönlicher Zuwendung
Dabei legen wir großen Wert auf die Therapie mit nichtpharmakologischen Interventionen, wie z.B.:
- das Verringern der Zeiträume, in denen die Patientin / der Patient sich selbst überlassen ist
- tagesstrukturierende Angebote
- Einsatz von Beschäftigungskisten / Erinnerungskoffern
- beruhigende Gespräche
- Angebot von Mobilisationsmaßnahmen, Lagewechsel bei bettlägerigen Erkrankten
- Angebot von Speisen und Getränken
Uns ist dabei vollkommen bewusst, dass wir weder das zuhause der Patientin / des Patienten kopieren, noch eine 24-Stunden dauernde Eins-zu-eins-Betreuung gewährleisten können. Allerdings haben wir mit unseren Maßnahmen bereits gute Erfolge im positiven Umgang mit oft anspruchsvoll zu betreuenden Patientinnen und Patienten erreicht.
Videos zum Thema Delir
Der JoHo-Verbund ist sich der komplexen Herausforderung des Delirs im Klinikalltag bewusst und setzt zahlreiche Maßnahmen ein, um es zu vermeiden, Betroffene zu erkennen und schnellstmöglich zu therapieren.
Neben der gezielten Schulung und Sensibilisierung des Personals, ist es dem Verbund ein Anliegen, Sie als Patient*innen und Angehörige umfassend über das Thema Delir zu informieren.
Die folgenden Videos wurden vom Projektteam „Delirmanagement“ des JoHo-Verbundes produziert. Sie fassen für Sie in aller Kürze alle wesentlichen Informationen rund um das Thema Delir zusammen.
Was ist ein Delir?
Das Delir ist ein unspezifisches Syndrom, welches sich vor allem in einer akuten Verwirrtheit zeigt. Es ist eine Notfallsituation und geht mit einer Funktionsstörung des Gehirns einher.
Das folgende Video veranschaulicht Ihnen was ein Delir genau ist und wodurch es ausgelöst werden kann.
Woran erkenne ich es?
Das Delir kann sich in verschiedenen Ausprägungen äußern und umfasst diverse Verhaltens- und Wesensveränderungen.
Das folgende Video veranschaulicht Ihnen woran ein Delir zu erkennen ist.
Was kann ich tun?
Als Patient*in und Angehörige*r können Sie einen wichtigen Teil zur Vorbeugung und Therapie eines Delirs beitragen. Insbesondere die Angehörigen können einen bedeutsamen Beitrag zur Behandlung eines Delirs leisten.
Das folgende Video veranschaulicht Ihnen, auf was Sie als Patient*in oder Angehörige*r während eines stationären Aufenthalts achten sollten.
Was tut das Klinikpersonal?
Das Personal des JoHo-Verbunds wird in regelmäßigen Abständen geschult und sensibilisiert. Sie integrieren in den Tagesablauf der Patienten und Patientinnen eine Vielzahl von Maßnahmen, um ein mögliches Delir zu vermeiden und sensibel mit den Betroffenen im Klinikalltag zu agieren.
Das folgende Video veranschaulicht Ihnen welche Maßnahmen das Personal ergreift.

Das räumliche Umfeld
Besonderheiten der räumlichen Umwelt und das subjektive Erleben der räumlichen und sozialen Umwelt sind wesentliche Aspekte der Lebensqualität von Menschen mit Demenz oder Patient*innen im Delir. Demzufolge stellt die die räumliche Gestaltung von Krankenhausstationen eine wichtige Komponente für eine demenz- / delirsensible Ausgestaltung von Krankenhäusern dar.
Die demenzsensible Gestaltung einer Krankenhausstation soll dazu beitragen, bestehende kognitive, sensorische und körperliche Beeinträchtigungen der Patient*innen zu kompensieren, umweltbedingte Stressoren zu vermeiden und nach Möglichkeit eine vertraute, beruhigende Umgebung zu schaffen.
Dazu ist eine räumliche Struktur erforderlich, die Sicherheit, Aktivität, soziale Teilhabe und menschliche Kontakte fördert. Ein entsprechendes Farbkonzept zur Ausgestaltung der räumlichen Umwelt kann die Wegführung zusätzlich unterstützen. In der praktischen Umsetzung bedeutet dies für das Otto-Fricke-Krankenhaus, dass jede Station ihre eigene Farbgebung erhalten hat. Zentrale Stationsbereiche wurden mit der jeweiligen Farbe gekennzeichnet. Bei der Farbgebung wurde darauf geachtet möglichst klare und freundliche Farben zu verwenden, die sich gut voneinander unterscheiden.
Station A1 = Sonnengelb
Station A2 = Blau
Station A3 = Grün
Station B1 = Orange
Station B2 = Aprikotgelb
Einen weiteren orientierenden Faktor bieten Bilderserien – aufgehangen auf den Fluren - mit einem geschlossenen Thema für jede Station. Diese können zusätzlich zu dem beruhigenden und orientierenden Charakter als ein therapeutisches Medium genutzt werden, indem sie für aktivierende Gespräche innerhalb der Therapien dienen. Unsere Bilder vermitteln Heimat, Wiedererkennen, Natur und Ruhe.
Zusätzlich wurden optisch gut abgesetzte Stationsschilder mit dem jeweiligen Stationsnamen an markanten Punkten angebracht, sodass sofort bei Betreten der Station und auch vom Flur aus die jeweilige Station zu erkennen ist.
-

Therapien
Sprach-/ Sprech- und Schlucktherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Neuropsychologie
-

Delirsensibles Krankenhaus
Sensibilisierung, Strukturierung, Raumgestaltung, Therapie
-

Geriatrie am Lebensende
Lebensqualität und letzte Wünsche
-
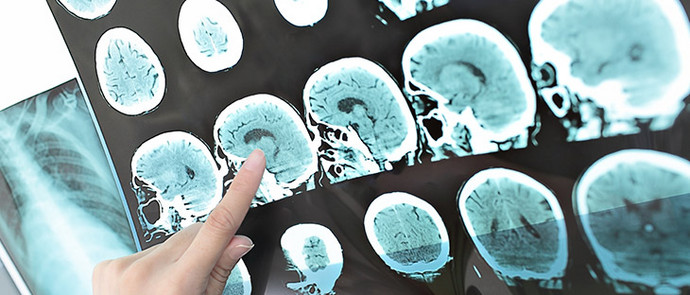
Neurologie
Diagnostik und Behandlung neurologischer Erkrankungen
-

Demenz
Diagnostik und Behandlung demenzieller Erkrankungen









